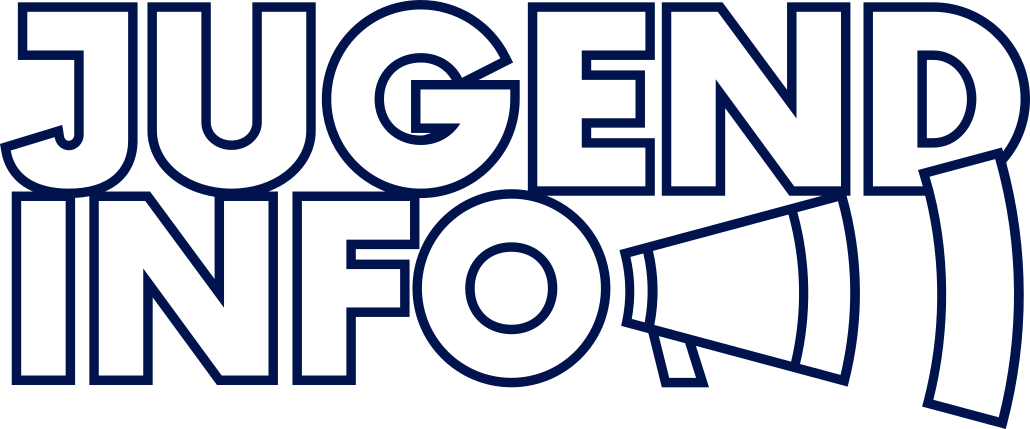Der Lockdown brachte Deutschland zum Stillstand. Schulen, Kitas, Restaurants und Clubs wurden geschlossen. Unternehmen verlagerten ihre Arbeit ins Homeoffice – wo es möglich war. Andere schickten ihre Angestellten in Kurzarbeit. Im privaten Leben galten strenge Kontaktbeschränkungen: Maximal zwei Personen aus unterschiedlichen Haushalten durften sich treffen, maximal fünf insgesamt in der Öffentlichkeit. Es war die Zeit, in der Hygieneanweisungen plötzlich allgegenwärtig wurden – Abstand halten, Masken tragen, Hände waschen.
Shutdown der Gesellschaft
Die Maßnahmen wurden damit begründet, die Infektionsketten zu unterbrechen und das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Doch es war eine drastische Entscheidung: Während einige Industriezweige weiterliefen und Konzerne weiter Profite machten, wurde das soziale Leben nahezu komplett stillgelegt. Die Regierung argumentierte mit dem „Worst-Case-Szenario“ – einem Strategiepapier des Innenministeriums zufolge sollte die Angst vor dem schlimmsten Verlauf der Pandemie die Menschen zur Einhaltung der Maßnahmen bringen.
Mit dem ersten Lockdown kamen auch rechtliche Änderungen. Die Reform des Infektionsschutzgesetzes im März 2020 gab der Regierung weitreichende Befugnisse, um Schutzmaßnahmen ohne Zustimmung des Bundestags zu verlängern. Gleichzeitig wurde die Maskenpflicht eingeführt. Anfangs war fast alles erlaubt: Selbstgenähte Stoffmasken, Schals, Halstücher – obwohl schon damals einigen klar waren dass diese Improvisiert Masken kaum halfen. Erst später setzte sich die medizinische Maske als Standard durch.
Alltag im Lockdown – ein digitales Chaos
Der Wecker klingelte. Ich stand auf, setzte mich an den Schreibtisch und klappte meinen Laptop auf. Eigentlich hätte ich jetzt Mathe, aber ob der Lehrer heute den Zoom-Call starten konnte? Unklar.
So oder so ähnlich sah ein Lockdown-Alltag für viele aus. Seit dem 13. März waren Schulen und Kitas geschlossen, Universitäten zogen kurz darauf nach. Was folgte, war ein chaotisches Experiment: Homeschooling ohne Konzept, Unterrichtsausfälle wegen technischer Probleme, überforderte Lehrkräfte und eine Spaltung zwischen denen, die zu Hause ein ruhiges Arbeitsumfeld hatten, und denen, die sich mit Geschwistern oder instabilen Internetverbindungen abmühten. Die Bildungspolitik war von der Pandemie überrumpelt worden – den Preis zahlte eine ganze Generation Schüler:innen und Studierende. Es zeigten sich die Versäumnisse der vergangen Jahrzehnte.
Besonders für Abschlussjahrgänge war diese Zeit eine Zerreißprobe. Während der Lockdown den Unterricht lahmlegte, hielten die Kultusminister an den Abiturprüfungen fest. Schülerinnen und Schüler schrieben ihre Prüfungen unter Bedingungen, die kaum fair zu nennen waren: Monatelanger Distanzunterricht, Prüfungsräume mit Maskenpflicht und Lüftungsvorschriften, Lehrer:innen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr unterrichteten. Wie gerecht kann eine Prüfung sein, wenn der Zugang zu Bildung in dieser Zeit so ungleich verteilt war?
Wer leidet am meisten?
Die Pandemie traf nicht alle gleich. Vor allem Jugendliche aus Familien in prekären Verhältnissen standen vor zusätzlichen Herausforderungen. Ohne eigene Laptops oder stabile Internetverbindungen blieb ihnen der Onlineunterricht oft verschlossen. Förderangebote, die vorher Defizite ausgleichen konnten, fielen weg. Laut einer Bertelsmann-Studie 2021 hatten Schüler:innen aus sozial schwachen Familien einen deutlich größeren Lernrückstand als ihre wohlhabenderen Mitschüler:innen.
Doch nicht nur die schulische Bildung litt. Auch die psychischen Belastungen stiegen rapide an. Eine Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf aus dem Jahr 2021 zeigte, dass depressive Symptome bei Jugendlichen während der Pandemie von 10 % auf 25 % anstiegen. Auch hier besonders betroffen: Jugendliche aus einkommensschwachen Familien. Isolation, Zukunftsängste und fehlende soziale Kontakte verstärkten die Krise.
Studierende zwischen Not und Bürokratie
Auch Studierende wurden von der Krise hart getroffen. Mit der Schließung von Unis und Bibliotheken fiel die gewohnte Struktur weg. Wer vorher in der Bibliothek lernte, saß plötzlich allein im WG-Zimmer. Seminare wurden in Zoom-Calls verlegt, Prüfungen fanden online statt – oder wurden verschoben. Für viele eine nervliche Zerreißprobe.
Hinzu kamen finanzielle Probleme. Der Nebenjob in der Gastronomie? Weg. Das Einkommen aus dem Einzelhandel? Fehlanzeige. Die Regierung reagierte mit dürftigen und eher symbolischen Überbrückungshilfen, BAföG-Anpassungen und Notfonds. Doch diese Hilfen kamen nur schleppend an. Der berüchtigte 500-Euro-Zuschuss wurde erst im Sommer 2020 eingeführt und war an hohe Hürden geknüpft – für viele fiel er weg. Eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung zeigte 2021, dass 40 % der Studierenden in finanzieller Not waren, aber nur ein Bruchteil Unterstützung erhielt.
Eine Krise mit Nachbeben
Der erste Lockdown war ein Ausnahmezustand. Doch viele Entscheidungen aus dieser Zeit wirken bis heute nach. Die Bildungsschere hat sich weiter geöffnet, psychische Erkrankungen sind gestiegen, und das Vertrauen in den Staat ist bei vielen erschüttert.
War der Lockdown notwendig? Vielleicht. War er gut vorbereitet? Sicher nicht. Und die Langzeitfolgen? Die sehen wir noch immer und komplett werden sie sich auch erst noch zeigen.