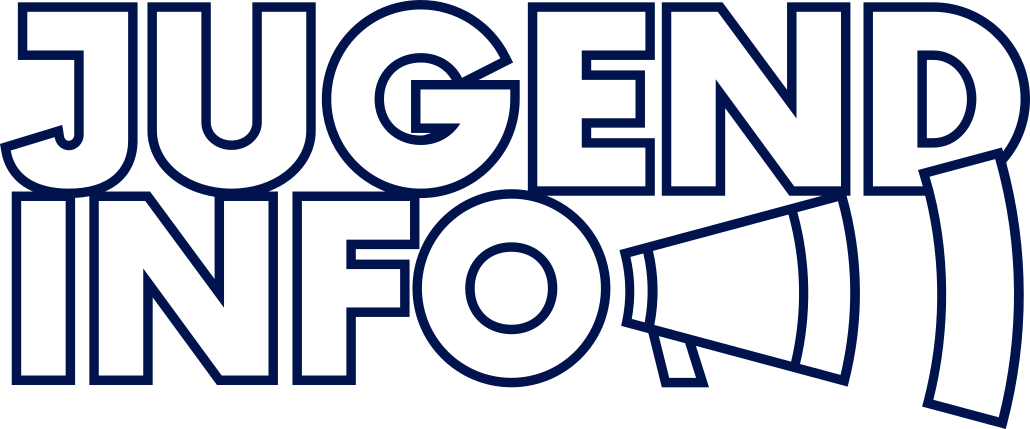Trumps „Liberation Day“
Die Vorboten des Zollkriegs waren die am 1. Februar angekündigten Zölle auf kanadische, mexikanische und chinesische Importe, welche aber gleich am 3. Februar wieder ausgesetzt wurden. Das gleiche Spiel am 4. März: Die US-Regierung verkündet Zölle in Höhe von 25% auf kanadische und mexikanische Einfuhren. Chinesische Importe sollen mit 20% Einfuhrgebühren belegt werden. Zwei Tage später werden auch diese wieder ausgesetzt.
Im April geht es weiter: die US-Regierung unter Trump ernennt den 2. April zum „Liberation Day“ an dem „die amerikanische Industrie wiedergeboren“ werde.
Noch am Abend des 2. April kündigte Trump dann in einer Pressekonferenz an, ab dem 5. einen Basiszollsatz in Höhe von 10% auf alle importierten Waren in die USA zu verhängen. Zusätzlich benannte er 90 Staaten, auf deren Importe zusätzliche Einfuhrgebühren verhängt werden. Darunter 25% für Autoimporte aus der EU. Noch bevor diese in Kraft treten konnten, wurden sie allerdings für 90 Tage ausgesetzt. Hiervon nicht betroffen waren die chinesischen Einfuhren; diese wurden mit 145% Zollgebühren belegt. Die chinesische Regierung reagierte mit Gegenzöllen in Höhe von 125%.
Die Ankündigungen und teilweise Verhängungen lösten in den weltweiten Regierungsgebäuden, wie auch an der Börse, starke Reaktionen aus. Der US-Börsenindex S&P 500, der die Aktien von 500 führenden börsennotierten US-Unternehmen umfasst, brach innerhalb von einem Tag um 5% ein. Und auch der deutsche DAX, der die Aktien der 40 größten deutschen Unternehmen umfasst, brach zeitweise um 10% ein. Von den US-Zöllen ist insbesondere die deutsche Autoindustrie betroffen, deren wichtigster Abnehmer die USA sind.
Der Unternehmensberatung Kearney zufolge könnten die Zölle auf Produkte der Automobilindustrie in Europa für den Verlust von bis zu 30.000 Arbeitsplätzen sorgen.
Wieso das Ganze?
Der angezettelte Zollkrieg ist kein spontaner Einfall, vielmehr könnte man ihn als eine unbeschönigte und beschleunigte Politik der USA beschreiben. Spätestens seit dem Ende der Sowjetunion 1989 und dem damit bedingten Ende der Blockkonfrontation versuchten die USA sich mit allen Mitteln als alleiniger Hegemon, der die eigenen militärischen und wirtschaftlichen Vorstellungen durchsetzt, an der Spitze zu halten. Beginnend mit dem 2. Golfkrieg gab es keinen Konflikt, keinen Krieg, der ohne die Einmischung der USA vonstatten ging – den Namen der Weltpolizei trägt sie nicht umsonst.
Diese hegemoniale Stellung wird jedoch immer weiter von China infrage gestellt. Spätestens seit der Wirtschaftskrise 2008 spekulieren immer mehr Wirtschaftswissenschaftler darüber, wann China die USA wirtschaftlich überholen könnte. Die Diskussionen liegen hier zwischen 2030 und 2035. Dies versucht die USA mit aller Macht zu verhindern. Die USA hat daher begonnen, ihren Fokus aus Europa und dem Mittleren Osten nach China zu verschieben. Einen Namen hat das ganze bereits 2012 unter Barack Obama mit „Pivot to Asia“ bekommen.
Der Nixon-Schock
Die USA ist nicht bereit, ihre Vormachtstellung zu räumen. Dennoch gerät sie in einer immer multipolarer werden Weltordnungweiter ins wanken. Auch wenn es vielleicht nicht so wirken mag, steht die USA vor dem Problem, mächtig verschuldet zu sein und vor einer immer weiter schwindenden US-Industrie. Die Ursprünge dafür lassen sich in den 70er Jahren finden.
Am 15. August 1971 erklärte der US-Präsident Richard Nixon das bisherige Weltwährungssystem für aufgehoben. Ein Tag, der als Nixen-Schock in die Geschichte einging. Von einem Tag auf den anderen galt das bisherige Bretton-Woods-System für aufgehoben. Der Grundstein für das heutige Handels- sowie Finanzsystem wurde gelegt.
Mit der Aufhebung des nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführten Währungssystems Bretton-Woods, das den US-Dollar zur führenden Währung erklärte, wurde die Goldbindung des US-Dollars aufgehoben. Mit der Aufhebung dieser Bindung, wurde die Grundlage geschaffen, dass sich Staaten bis ins Unendliche verschulden konnten. Aufgrund der Finanzstärke der USA blieb der US-Dollar dennoch die führenden Währung auf dem Weltmarkt, auch ohne ein festes Abkommen.
Die USA begannen sich massiv zu verschulden, vor allem zur Finanzierung des Vietnamkriegs. Um diese Ausgaben zu decken, gaben sie Staatsanleihen aus, die von anderen Ländern gekauft wurden. Diese Anleihen gelten als sichere Anlage, da die USA als kreditwürdig anerkannt sind. Die Käufer erhalten regelmäßige Zinszahlungen und am Ende der Laufzeit die ursprüngliche Leihgabe zurück.
Die USA als Weltmacht
Dieses System funktioniert jedoch nur so lange, wie der US-Dollar eine sichere Währung bleibt. Sinkt der Wert des Dollars, werden auch die Zinsen wertlos. Das System hat jedoch noch einen anderen Haken für die USA: abgesehen davon, dass die USA sich sehr stark verschulden, hat es dazu geführt, dass die industrielle Produktion immer weiter abgewandert ist. Durch den stärkeren Handelsverkehr importierten die USA immer mehr Waren und begannen eigene Industriestandorte abzubauen.
Trotz ihrer Stärke auf dem Finanzmarkt haben die USA mit einer Deindustrialisierung zu kämpfen. Diese versucht Donald Trump mit dem Verhängen von Zöllen rückgängig zu machen, um somit die inländische Wirtschaft wieder anzukurbeln. Auf der anderen Seite versucht Trump andere Staaten durch die Zölle zu Verhandlungen zu zwingen, um so für die US-Exporte eine Senkung der Abgaben erzielen zu können.
Verhandlungen werden jetzt augenscheinlich Fahrt aufnehmen, so reiste die italienische Regierungschefin Meloni ins Weiße Haus, um dort das Gespräch über ein mögliches Handelsabkommen zwischen der EU und der USA vorzubesprechen. Trumps Plan geht also auf. Dass er in dieser Frage als erste Meloni empfängt, sollte nun auch nicht mehr überraschen. Trump hat in der Vergangenheit bereits sehr genau seine engen Vertrauten in Europa ausfindig gemacht.
Die Welt befindet sich im Wandel und die Interessen der Staaten wie auch der Konzerne treten immer offener zutage. Der Zollkrieg ist keine reine Schlammschlacht und Trump hat auch nicht den Verstand verloren, er ist sich ziemlich bewusst, was er da tut: Verwirrung stiften, Grenzen austesten, den Einfluss seiner Entscheidungen auf Volkswirtschaften rund um die Welt unter Beweis stellen und nicht zuletzt die eigene Finanzmacht, insbesondere vor China, zu sichern.